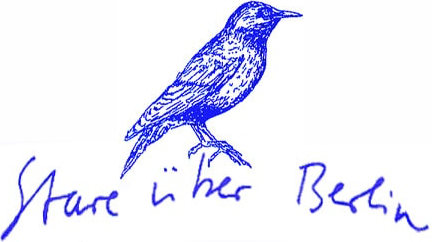Julia Gerlach
ent zaubert
ver
Stichwörter zur Internet-Kunst von Tilman Küntzel
schlafend
Im Wesen immateriell, bedarf der digitale Inhalt des Internets, der in einer Art Schneewittchenschlaf auf weltweit verstreuten Servern ruht, für seine Entzauberung der menschlichen Handlung. Das Netz ist ein Ort des Potentials, nicht der Existenz. Nicht nur, weil es ein unermeßliches Reich an Informationsklassen, Sach-Inhalten, Freizeit- oder Lebensbewältigungsangeboten verwahrt, sondern auch, weil in ihm verschiedenste Formen, mit sich und anderen zu kommunizieren, individuelle Strategien der Informationsbeschaffung und Erlebniswelten entwickelt, ausprobiert oder erfahren werden können. Und: es sind unendlich viele verschiedene Zugriffe, Navigationsdramaturgien und inhaltliche Verknüpfungen in einer zuvor unbekannt rasanten Geschwindigkeit möglich. Das Netz enthält also neben einem Informationspotential auch ein Kommunikations- und Assoziationspotential.
wohnend
In den ersten Jahren, denen vor der systematischen Kommerzialisierung, wurde das Netz verhältnismäßig intensiv für künstlerische Projekte genutzt. Heute hat sich zwar die Anzahl insgesamt erhöht und die Projekte sind aufgrund der verbesserten Datenübertragung vielgestaltiger und musikalischer geworden, allerdings ist auch der demokratie-euphorische, in Zügen gar anarchistische Entdeckergeist entwichen, der dem Netz zunächst innezuwohnen schien. Neuere Projekte sind mehr auf Praktikabilität ausgerichtet, bedienen sich einer ausgefeilten Technologie und sind tendenziell seriöser. Das Netz ist mittlerweile Gefäß für jede Form und Gattung. Netzkunst ist hoffähig geworden und hat sich auf den Medienkunstfestivals („transmediale“, Berlin; „intermedium“, Karlsruhe etc.) etabliert, und auch Netzmusik, die musikstilistisch dem aktuell-experimentellen Lager am nächsten steht, ist dort mehr beheimatet als in angestammten Musikkontexten.
zweigleisig
Es ist gerade das Kommunikationspotential, auf dem netzmusikalische Arbeiten aufbauen. Zwei Ansätze, deren ästhetische und situativ-kommunikative Bedingungen sich grundlegend unterscheiden, trifft man besonders häufig an:
a) Die Kommunikation zwischen zwei oder mehr Menschen über das Netz, die im Grunde aus einem Datenaustausch besteht, basiert auf dem Prinzip der Vernetzung.
b) Die Situation, daß ein Nutzer mit einer vorprogrammierten, sich ihm in einer audiovisuellen Darstellung präsentierenden Struktur interagiert, wird am treffendsten mit dem Begriff des „Bildschirmhörens“ (Golo Föllmer) charakterisiert.
Bei ersteren Projekten (a), die die reziproke Kommunikationsstruktur des Netzes ausnutzen, werden ein oder mehrere Musiker über die Datenleitung miteinander verschaltet und kommunizieren rein akustisch miteinander (unvermeidlich mit delay) oder über visuelle Abbilder der Steuerparameter. Diese Vernetzungssituationen, an denen der Rezipient weder aktiv noch selber am Bildschirm sitzend partizipiert, ereignen sich meist in traditionellen Kunstkontexten. Der rezeptive Akt ist passiv, mitunter gar kontemplativ.
Der andere, verbreitetere Ansatz (b), der auf der internetspezifischen Situation des Surfens und Bildschirmguckens aufsetzt, fordert eine veränderte Rezipientenhaltung und ist in diesem Sinn innovativer. Die spielerisch-neugierige Eigenaktivität des Netz-Nutzers ist meist unabdingbare Voraussetzung dafür, daß sich diese Projekte realisieren. In der Eigenaktivität, die in Grad und Qualität sehr unterschiedlich ausfallen kann, ist nicht selten der eigentliche ästhetische Wert des Projekts verankert.1
Die gesamtgesellschaftliche Bedeutung des Internets spielt als Kontext und Ideengeber ebenso eine wichtige Rolle für Bildschirmmusik wie seine programmiertechnischen und kapazitären Limitierungen. Innerhalb des massiv bildflutig verstopften Internets muß sich ein künstlerisches Projekt durch sich selbst als Kunst auszeichnen, es wird nicht durch eine Kulturinstitution vorgefiltert und einem Publikum präsentiert. Ohne das Bekanntwerden der Web-Adresse verweilen Netzprojekte auf ewig im Schneewittchenschlaf.
kurzsichtig
Das Internet ist unüberschaubar, wirr, labyrinthisch, schnell und beliebig, eine überbordende Informationsflut. Es gibt keine Abstände zwischen den Informationen. Psychische, soziale und kulturell-intellektuelle Distanzen, die das Handeln in der realen Welt mitbestimmen, sind bei der Orientierung im Netz kaum von Bedeutung. Der Computerbildschirm ist wie ein SIchtfenster, in das immer wieder neue „visuelle Oberflächen“ geschoben werden. Die dahinter verborgene Verknüpfungslogik, die Tiefenstruktur des Netzes ist (begrifflich-) abstrakt und entbehrt jeglicher räumlichen Erfahrung (auch wenn das Netzt oft mit räumlichen Metaphern faßlich gemacht wird). Für die Orientierung im Netz müssen neue Kriterien gelernt werden. Tendenziell ist alles zugänglich. Normativ für die Navigationsprogrammierung im Internet ist – der Anspruch kann zumindest in dieser Weise definiert werden –, daß keine Hindernisse, keine Überraschungen und Irritationen der zielgerichteten Fahrt durch die Tiefen des Informationsnetzes entgegen stehen. Eine eindeutige Aktions-Reaktions-Zuordnung ist die Grundvoraussetzung dafür, daß sich der Nutzer im Netz nicht verliert, sondern er in seiner erwünschten Kontrollfähigkeit bestätigt wird. Das allerdings ist künstlerisch uninteressant.
arm
Gegenüber den Attributen des kommerziellen Netzes nehmen sich die Internetobjekte von Tilman Küntzel arm aus. Sie sind reduziert nicht nur in dem, was man sieht, sondern auch der Umgang mit ihren einfachen, aus anderen Kontexten bekannten Elementen ist genau abgezirkelt. Wie an einer weißen Galeriewand präsentiert Küntzel kleine Piktogramme, die Spieluhren ähneln oder klingende Embleme, die der Bildschirmhörer spielerisch erkundet, in Gang setzt und einstellt.
entstaubt
Küntzel bezieht sich in seinen Internetprojekten auf die konkrete Wirklichkeit, deren Bildhaftigkeit, Klang und Alltagssemantik. Fliegen, Gartenzwerge, Signalampelfarbenrot und -grün, Webstühle, Puppen, pointilistisch aufgepixelte Frauenkopfbilder – Küntzel installiert keine abstrakten Elemente, aber auch keine Elemente, die typisch wären für unsere hochtechnisierte Informations- und Medien-Gesellschaft, sondern Gegenstände, die einer rituell-archaischen oder vorindustriellen, zuweilen auch spießig-kitschigen Welt entsprungen zu sein scheinen. Sie widerspiegeln nicht den Stand der Welt, entsprechen nicht dem Zeitgeist, aber sind auch noch nicht vollständig aus unserer Lebenswelt verschwunden, sie sind höchstens angestaubt. Diese inhaltliche Unzugehörigkeit zum Präsentationskontext Internet schafft einen semantischen Abstand, eine Unterbrechung, die den Raum freigibt, um umzuschalten und sich auf die Objekte einzulassen. Küntzels ästhetische Positionierung erinnert an die italienische Arte Povera der sechziger Jahre in seiner begriffsursächlichen Variante:
„Die Geschichte der Dinge wird bedeutsam, und man stellt sich gerne in eine handwerkliche oder bäuerliche Tradition. &Mac226;Arm‘ heißt also nicht ärmlich, dürftig, schäbig, sondern ist […] dem &Mac226;reichen‘ Apparat eines in Anspruch, Stil und Bedeutung festgelegten Kunstbetriebs entgegengesetzt. &Mac226;Arm‘ meint eine Reduktion der instrumentellen Mittel, eine Besinnung auf die eigene Person, die Möglichkeiten des eigenen Körpers und die Interaktion mit dem unmittelbaren Umfeld, eine Wertschätzung der Materialien und der Natur. &Mac226;Arm‘ versteht sich in der Gegenüberstellung zu einer von Wirtschaftswunder, Massenmedien und Technologie geprägten Umwelt.“2
singend
Obgleich Küntzel mit dem Internet operiert, verhalten sich seine Netzobjekte zu diesem wie ihre Antithesen. Sie sind geradezu wohltuende Ruhestätten im Ein-und-Vielerlei. In ihnen kombiniert der Künstler Erfahrungen und Elemente aus der Alltagswelt mit Brechungen internet-typischer Verhaltensweisen. Diese doch recht reduzierten Handlungsspielräume und Aktionen setzt Küntzel aber eben nicht eins zu eins um, sondern in leichter Abweichung oder sie greifen überhaupt nicht. Das „drag“ funktioniert – der Gartenzwerg läßt sich bei gedrückter Maustaste über den weißen Bildschirm und darin verborgene CD-gescratchte Sounds ziehen –, das „drop“ – ein Absetzen des gezogenen Gartenzwergs an anderem Ort – jedoch nicht und so kehrt DER SINGENDE GARTENZWERG, sobald man die Maustaste losläßt, unbeirrt an seinen ursprünglichen Standort vor dem Mauerwerk zurück, das in der Silhouette des Zwergs sichtbar wird, wenn der User den Gartenzwerg auf die weiße Fläche zieht. Was die Kontrolle der klanglichen Komponente anbelangt, wird der Rezipient ebenso getäuscht wie beim Visuellen. Zunächst vermeint man, wenn man den Gartenzwerg mit der Maus auf einen Ort zieht und dort verharrt, einen CD-Hänger zu verursachen, also ein akustisches Auf-der-Stelle-Treten. Tatsächlich läßt sich der Klang im Detail genausowenig steuern, wie die Verortung des Gartenzwergs. DER SINGENDE GARTENZWERG widersetzt sich der Kontrollierbarkeit, die für das Navigieren im Internet sonst typisch ist. Gartenzwerg bleibt Gartenzwerg.
irrend
Beim Projekt DER ERROR MAN, einem weiteren Internetobjekt Küntzels, ist der Weg einfach und visuell eindeutig: Ein bogenförmiger Pfeil aus signalfarbenroten Punkten lotst zu einem zuckenden grünen Punkt. Dem roten folgt man mit der Maus – „gefundene“ geloopte Klänge kommentieren, eine Stimme verspricht warnend „danger“ – und erwartet wohl etwas vom pointierten Grünpunkt. Die Logik des Internets – mit-Buttonklick-in-ein-neues-Universum – wird jedoch nicht erfüllt. Statt dessen hört man bei grün „yes or no“ und da keine Entscheidungswege implementiert sind, bleibt es bei der unauflösbaren Dichotomie, der visuellen Oberfläche und den darin symbiotisch aufgehobenen Klängen3, also im Hier und Jetzt des audiovisuellen Internetobjekts. Der Pfeil führt nirgendwohin.
fliegend
Fliegen lassen sich im Gegensatz zu Gartenzwergen per „drag & drop“ umplazieren. Zwischendrin surren sie unberechenbar über den Bildschirm. Mit der gezogenen Fliege kann man versteckte Gesangsfetzen auslösen. Dabei wird zunächst nicht deutlich, ob der diskontinuierliche Vortrag den eigenen Mauszuckungen zuzuschreiben ist. Dieser Eindruck verändert sich auch nicht, wenn man es besser weiß. Denn tatsächlich sind die programmierten Klänge fragmentar. Dennoch wird die Abweichung vom gewohnten Klangverlauf der Eigenaktivität zugeschrieben. Für DREI FLIEGEN, EINE SINGT ist wie auch für den SINGENDEN GARTENZWERG entscheidend, daß die versteckten manipulierten Klänge keine visuelle Entsprechung haben. Die räumliche Klangtopographie ist bewußt unsystematisch und unkontrollierbar gestaltet. Das Moment der Überraschung und der leichten Irritation sind hier die entscheidende Erlebnisqualität. Fliegen lassen sich nur schwer fangen.
lachend
Die Undurchsichtigkeit der Aktionszusammenhänge bei diesen Küntzel-Projekten irritiert und erhöht den spielerisch-erkundenden Anteil der Rezeption. Gewohnte Handlungsmechanismen werden gebrochen oder en passant ad absurdum geführt. Die Irritationen, die so oder durch semantische Offenlegungen entstehen, bewirken ironische Distanz – auch zum kommerziellen Internet. Überraschung und die frappierende gebrochene Einfachheit der Objekte inaugurieren eine im unsinnlichen Netz nur selten zu findende ästhetische Kategorie: Humor.
Anmerkungen:
1 Vgl. auch Golo Föllmer, Musikmachen im Netz. Elektronische, ästhetische und soziale Strukturen einer partizipativen Musik, Diss. Halle 2002, D. i.V.
2 Arte Povera. Manifeste, Statements, Kritiken, hrsg. von Nike Bätzner, Dresden: Verlag der Kunst 1995, S. 21 f.
3 Wie seine Klanginstallationen besitzen auch Küntzels Internetobjekte eine dichte und zugleich weiche Verbindung von Visuellem und Akustischem. Meist existiert zu jedem visuellen Element ein klingendes Pendant und umgekehrt.