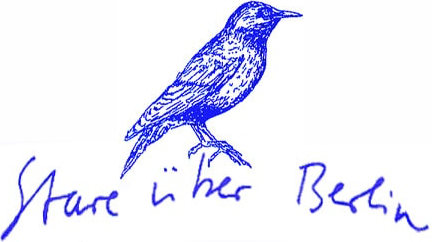Jean-Baptiste Joly
aus einem Gespräch mit Tilman Küntzel. Akademie Schloss Solitude 1999
JBJ: Vielleicht fangen wir mit der Installation im Kabinett an, die aus der Arbeit entstanden war, die Sie im Mai in Berlin realisiert hatten?
TK: Für die Klanginstallation mit dem Leuchtkasten in der Galerie K & S hatten wir die Leuchtdioden angezapft und Relais einmontiert um damit perkussive Instrumente und Spieluhren zu steuern. Das Klicken der Relais allein schon fand ich toll, so wie wir sie der Reihe nach im Kasten angeordnet hatten. Das klick, klick, klick, klick in der Abfolge der Leuchtintervalle….
JBJ: …wie es jetzt im Kabinett mit den halbierten Ping-Pong Bällen an den Relais zu hören ist.
TK: Die Schlagzeug-Instrumente waren mir doch etwas zu laut, ich habe lieber die leisen Töne. Für den Ort aber war es in Ordnung, da es sich ja um eine Phrase zu einem Werbeslogan handelt der „mit Pauken und Trompeten“ daher kommen kann. Durch die Snare-Drums und den diversen Trommeln hatte es etwas von Spielmannszug, wobei Leuchtreklame und Spielmannszug ja durchaus vergleichbare Funktionen haben, nur andere Mittel einsetzen, um das Ziel Aufmerksamkeit zu erreichen.
JBJ: Ja, die Galerie ist direkt an der Straße, mit viel Straßenlärm: Man kommt herein und es ist auf einmal in dem kleinen Raum alles zu viel, zu nah, zu laut und passt deshalb auch so gut mit der Straße zusammen. Eine so laute Installation könnte ich mir hier im Kabinett wiederum nicht vorstellen.
TK: Es passte gut in die Tucholskystraße in Berlin-Mitte, so wie es auch eine gute Situation in der „Music Gallery“ in Toronto, Kanada war, wo ich eine erste Version realisieren konnte. Die Trommeln waren hier ein Teil, Spieluhren, die ich in Toronto in einem Gebrauchtladen für elektronische Elemente fand, ein anderer. In Berlin habe ich die Transportkoffer der Instrumente benutzt, einen Holzblock und Glöckchen. Es gibt so viele Variationsmöglichkeiten, so dass ich bei jeder Präsentation eine neue Instrumentierung vornehmen kann.
JBJ: Gestern sprachen Sie von Klang, als wir durch die Räume gingen; einmal sagte ich Musik und sie korrigierten mich: „Nein, nein, Klang“.
TK: Wie soll man Musik definieren? Musik hat für mich mehr mit Harmonik zu tun und vor allem mit Formverläufen. Was ich hier in der Ping-Pong Version mache, ist eine Konstruktion von nahezu identischen Geräuschen, die im Raum angeordnet sind.
JBJ: In der K & S Galerie hatten Sie doch mit Harmonik gespielt, indem Sie die einzelnen Instrumente sehr genau einsetzten.
TK: Das war eine musikalische Phrase, die ich auch als Musik bezeichnen würde. Oder besser gesagt, es war ein paar Sekunden Musikfragment, das sich immer wiederholt.
JBJ: Und wenn man an die berühmte Cage-Definition von Musik denkt, Musik sei nichts als eine organisierte Zeitsequenz?
TK: Dann trifft es auch auf meine Arbeiten zu.
JBJ: Sie sagen manchmal Geräusch, manchmal Klang, etwas zögernd sagen Sie jetzt auch Musik, ist es Bescheidenheit?
TK: Vielleicht Bescheidenheit, vielleicht ist es die Relativität der individuellen Begriffsbestimmung. Es geht in meinen Installationen ja auch immer um das Zusammenwirken von Hören und Sehen. Draußen im Baum ist es ganz klar ein musikalischer Dreiklang, ein Sept-Akord, der, je nach Sonnenstand, Intensität und Position sowie Empfindlichkeit der Solarpaneele, in variierender Rhythmik erklingt. Es ist ein Dreiklang und nicht weiter organisierte Musik, noch nicht. Es ist wie eine Figur aus drei Strichen, die durch immer neue Anordnungen neue Bilder ergeben. Vieles sind für mich auch Studien, Fragmente, Beispiele, die ein System verdeutlichen.
JBJ: Sie beschreiben hier eher die Entstehung einer Grammatik, die eine Sprache möglich macht. Die Sprache wäre etwas, was dahinter steht…
TK: Grammatik, Sprache, die Semiotik meiner Licht- und Klanginstallationen eben. Bei dieser Ausstellung gibt es auch noch die globale Ebene, wo die Prosodie durch das Zusammenwirken der verschiedenen Räume entsteht, die einzelnen Arbeiten für sich aber Morpheme, wenn nicht Phoneme darstellen.
JBJ: Morpheme ja, Ansätze ja… Gibt das Ganze nicht etwa eine Art Hoffnung auf Musik, wie auf eine Sprache? Die eigentliche Musik wäre aber nichts als eine Vorstellung, die jeder Hörer im Kopf bilden und nicht unbedingt physisch hören würde: Etwas Unerreichbares, eine Vorstellung.
TK: Die Arbeit gibt viel Interpretationsfreiheit, und jeder hat seine eigenen Geschichten, wie z.B. im oberen Hirschgang mit den Rosen. Ich habe von den Besuchern bereits so viele Assoziationen gehört; von „Froschkonzert“, über „Laufen auf Eis“, bis hin zu „im Winter auf einem See, wo das Eis Risse zieht“….
JBJ: Aber ich meine etwas anderes: Sie reden z.B. auch von Konzeptkunst. Vor einigen Wochen hatten wir in einem Gespräch bei Ihrer Arbeit „Lights and Sounds“ über Joseph Kosuth und seine Arbeit mit den gelben Neonwörtern gesprochen, über die Frage, ob es das Kunstwerk selbst ist, das sich behauptet, oder bereits ein Abbild, ein Kommentar? Man könnte sagen, dass die konzeptuelle Dimension Ihrer Arbeit vergleichbar wäre: Lichter und Klänge, die von ihrem eigenen Kommentar ausgelöst werden. Vielleicht steckt auch die konzeptuelle Dimension Ihrer Arbeit hinter dieser Oberfläche; es ginge um eine konzeptuelle Vorstellung von Musik, die man physisch nicht erleben, die man sich nur vorstellen kann, ein Ideal…
TK: Mit meinen installativen Arbeiten fokussiere ich eben nicht nur auf Klänge bzw. Musik, sondern auf das Zusammenwirken, die Synästhesie auditiver und visueller Wahrnehmung. Andererseits mache ich auch gern eine klare Trennung zwischen Klang bzw. Musik und visuellen Dingen. Die Raumerfahrung und die Subjektivität des Betrachters spielen dabei eine wichtige Rolle. Die figürlichen Elemente, die ich einbinde, erwecken beim Betrachter bestimmte Assoziationen: Das, was man sozusagen als Altlast mit sich herumträgt. Jeder Mensch hat in seinem Kopf eigene Begriffe von Bildern, und wenn er in eine Ausstellung kommt, werden alle diese Erinnerungen und Assoziationen subjektiv freigesetzt. Damit gehe ich bewußt um und lasse weitestgehend Interpretationsmöglichkeiten und Erklärungen offen, so dass jeder eigene Bilder entwickeln kann. Ein Musiker würde es vielleicht schwerpunktmäßig musikalisch / analytisch hören und es wie Musik aufnehmen, aber ein Literat oder ein Architekt wahrscheinlich weniger. Sie würden sich eher grammatische Konstruktionen oder Formen vorstellen. Bei bestimmten rhythmischen Figuren würde das einem Architekten vielleicht als Form erscheinen, als Gebäudekomplex, der bestimmte Ecken und Kanten und Ausbuchtungen hätte.
JBJ: Jetzt nähern wir uns der Vorstellung von vorhin: Aus einer Konstellation von Klängen, die in einem Raum wahrgenommen werden, kann die Vorstellung davon Musik sein; sie kann aber auch räumlich, oder auch literarisch-sprachlich sein.
TK: Es geht in meiner Arbeit um die Erweiterung dieser Wahrnehmungsbegriffe. Musik ist natürlich nicht nur das, was im Konzertsaal stattfindet; es ist auch Musik, was der Wind veranstaltet, oder das, was die Vögel oder Frösche von sich geben. Dieses Bewußtsein zu haben und auf seine Umgebung zu lauschen, diese Geräusche einfach so wie sie sind aufzunehmen, das haben wir weitgehend verlernt. In der modernen Gesellschaft haben die Menschen zunehmend gelernt zu selektieren, um nicht völlig wahnsinnig zu werden von dem Überfluß an Reizen. Für mich besteht die Funktion der Kunst darin, die Menschen zu ganz fundamentalen Wahrnehmungsmechanismen zurückzuführen. In der Gesellschaft hat die Kunst auch die Funktion des Sich-Besinnens, des Reflektierens, die Funktion einem die nötige Ruhe zu verschaffen, so dass man die Poesie wieder erleben kann.
JBJ: Wo befindet sich für Sie der Ursprung des Wortes Synästhesie? Gehört es eher in die Kunst, oder sehen Sie es als einen Begriff aus dem Bereich des Klinischen?
TK: Eher des Klinischen. Unsere Wahrnehmung funktioniert in einer bestimmten Weise und das läßt sich medizinisch erklären. Jedes Hirn ist aber auch anders geschult; das ist ein Thema, das mich immer beschäftigt hat. In meiner Zeit an der Kunsthochschule habe ich viele Selbstversuche unternommen. Ich habe z.B. mit dem Medium Video gearbeitet, das es mir ermöglichte, eigene Bilder auf vorproduzierte Geräusch-Collagen zu montieren. Es ging darum, eine wirkliche Balance zwischen Bild und Klang zu erzeugen, so dass das Bild auch den Klang beschreibt, nicht nur der Klang das Bild, wie üblich….
JBJ: …untermalt…,
TK: …so wie wir es von jedem Film gewohnt sind. Der Film „Regen“ von Joris Ivens ist da ein gutes Gegenbeispiel. Es sind nur Einstellungen von Wolken und Regen, mal aufs Fenster, mal in eine Pfütze tropfend zu sehen. Hans Eisler hatte dafür das Quintett „Vierzehn Arten den Regen zu beschreiben“ (op. 70) geschrieben, die als eine seiner „kompliziertesten“ Kompositionen gilt. Hier funktioniert die Wechselbeziehung zwischen auditiver und visueller Ebene sehr gut, weil die Musik mehr über das Bild „reflektiert“ als ihm folgt und so auch funktionieren kann und nicht nur beschreibend die Bilder untermalt. Beide Ebenen funktionieren separat, ohne sich gegenseitig etwas wegzunehmen.
JBJ: Wenn ich jetzt auf das zurückblicke, was Sie seit einem Jahr gemacht haben, Ihr erster öffentlicher Auftritt hier auf Solitude im Oktober 1998 zusammen mit Alvin Lucier, dann im Klangraum in Stuttgart, Ihre kontinuierliche Arbeit während Ihres Aufenthaltes hier, im April die Arbeit in Budapest, im Mai in der Galerie, zum Schluß hier, dann bringt es mich zu der eigentlichen Frage, die ich Ihnen seit langem stellen möchte: Wie denken Sie Ihre Arbeit zwischen Klang und Raum, wie entscheiden Sie, dieses kommt hierhin, jenes dorthin? War in diesem Zusammenhang die Begegnung letztes Jahr mit Alvin Lucier eine wichtige Erfahrung für Sie?
TK: Die Arbeit von Lucier kannte ich bereits recht gut; die Erfahrung mit ihm, hier auf Solitude, hat mich eher darin bestärkt, so zu arbeiten, wie ich arbeite: z.B. mit den Naturgewalten, mit der Sonnenenergie oder mit Windenergie, wie bei den klingenden Windsäcken. Lucier greift eben diese Naturphänomene auf, integriert sie in die Kunst und erweitert den ganzen Begriff der musikalischen Komposition auf Mechanismen, die physikalisch begründet sind oder in physikalischen Gegebenheiten vorkommen. Er nimmt sie aus dem Kontext der Physik heraus – wie die Alphawellen z.B. – und stellt sie in den Zusammenhang der Kunst, macht daraus Konzerte: das kannte ich bereits gut. Für mich hat die Begegnung den Mythos Alvin Lucier etwas relativiert, weil man plötzlich einen Menschen vor sich sah, der genau so viel Unsicherheit mit sich herumträgt und seinen Job wie ein normaler Mensch macht.
JBJ: Auch eine Bestätigung?
TK: Ja, aber vor allem konnte ich aus der Nähe erleben, wie Lucier arbeitet, wie er seine Mechanismen herausarbeitet. Wie spielerisch kann der Mensch sein, was für ein Kind steckt eigentlich noch in ihm, das sind die Fragen, die sich für mich stellen. Ich glaube, dass ich diesen spielerischen Ansatz auch habe, dass ich auch diese Lust empfinde, andere Menschen auf bestimmte akustische Phänomene aufmerksam zu machen. Das wird sichtbar in dem Projekt in Budapest oder bei denen, die ich hier machen konnte. Sie haben immer mit dem Charakter des Ortes zu tun und damit, was dort möglich ist. In Budapest z.B. habe ich mir ausführlich, auch mit Fotos, erklären lassen, wie die Räumlichkeiten dort sind und habe mich für diese Installation im Treppenhaus entschieden. Es ging dabei um Bewegung, um Umsetzung von Lichtimpulsen in Bewegung, die Aktionen „An“ und ”Aus“ der beiden Rosen werden in ein Zeitparameter gebracht. Das hat für mich mit Musikalität zu tun, auch, wenn es nicht klingt und es nur Bewegung ist, was wir sehen. Oder wenn sich die zwei Autos in verschiedenen Geschwindigkeiten ruckweise fortbewegen, läßt sich das auch musikalisch interpretieren, z.B. als Paraphrase zur Form des Rondo.
JBJ: Sie sind jetzt nicht mehr weit von diesem Ideal der Musik.
TK: Formalistisch vielleicht. Ich bin in einem musikalischen Elternhaus aufgewachsen und war dadurch früh mit Struktur- und Werkanalyse konfrontiert. Daraus entwickelte ich, manchmal auf sehr abstruse Weise, meine eigene Umsetzung.
JBJ: Ist die Installation im unteren Hirschgang, in der Licht- und Tonsignale durch einen Spielautomat gesteuert werden, in diesem Sinne auch eine musikalische Komposition?
TK: Ja, ich sehe hier Parallelen: Es gibt vorgegebene Abläufe, deren Bestandteile durch Zufallsprogramme, wie Würfel im Becher, gemixt werden und in immer fortwährenden Varianten zu Tage treten. Eine „Symphonie“ aus 36 (+3) Einzelstimmen aus Leuchten, die seriell aufleuchten und als Ballett aus Lichtkegeln auf dem Boden erscheinen. Wie in einer Fuge liegt ein Thema zugrunde, das dann in verschiedenen Weisen variiert wird, bis ein zweites Thema dazu kommt, sich mit dem ersten vermischt, was ein drittes Thema ergibt, bis man wieder zum ursprünglichen Thema kommt usw. Eine ganz klassische Form eigentlich, mit dem Unterschied, dass man die Struktur und die Verläufe nicht als Klänge, sondern als Lichtbewegungen wahrnimmt. Aber doch ist es eine Komposition, da sich vorgefertigte Phrasen variieren. Komposition ist nicht nur Klang, sie kann genauso Form, Farbe, Bewegung und Licht sein. Gerade bei den Arbeiten mit Lichtobjekten wirken die visuellen und die auditiven Formen gleichzeitig auf den Betrachter ein, dessen Wahrnehmung subjektiv ist – ja nach Sozialisation und späterer Spezialisierung im Arbeitsleben. Gemeinsam ist aber allen Menschen eine individuell unterschiedlich ausgeprägte Unzulänglichkeit synästhetischer Wahrnehmung, die zu einer Balanceverschiebung beim simultanen Sehen und Hören führt. In „Ein kleiner Rosengarten“ z.B. erklingt faktisch genau gleichzeitig mit dem Aufleuchten einer Rose auch ein Geräusch, aber das kriegt man nicht zusammen, weil die Augen viel träger reagieren als die Ohren – was vielleicht naturgeschichtlich aus dem Fakt zu erklären ist, dass die Urmenschen immer auf der Hut vor Gefahren sein mußten, daher die Ohren immer offen hielten, um kleinste Impulse als Gefahrenquelle ausmachen zu können.
JBJ: Setzen Sie dieses Prinzip der Verschiebung auch im unteren Hirschgang ein, wo Lichtsignale durch einen Spielautomat erzeugt werden?
TK: Weniger, diese Installation stellt für mich eher ein Spiel gegen die Erwartung dar. Der Besucher, der Geld einwirft, erwartet in der Regel, dass etwas Zusätzliches passiert. Es passiert aber genau das Gegenteil: alle Lichter gehen aus und in unterschiedlichen Abfolgen, die auch jedes Mal anders sein können, gibt es erst drei akustische Signale, dann ein paar Sekunden gar nichts. Dann, je nachdem, was der Verlauf ergeben hat – es ist ja ein Zufallsgenerator mit zig Möglichkeiten in dem Automaten – wiederholt sich der Vorgang. Bei „Gewinn“ gibt es verschiedene Lichtimpulse, dazwischen kurze oder längere. Dann wiederholen sich diese Klangereignisse in verschiedener Reihenfolge. Ohne Gewinn setzt wieder das „Basislichtspiel“ mit dem „Grundmaterial“ ein. Diese Arbeit ist ein symphonisches Lichtspiel (und so heißt sie ja auch) in Interaktion mit dem Betrachter, der nicht das vorfindet, was er gewohnt ist. Dadurch wird er viel aufmerksamer auf das, was passiert, als wenn alles, was passiert, schnell zu durchschauen wäre. Wenn man als Künstler immer den Erwartungen gerecht werden würde, dann wäre man ein Dienstleistungsbetrieb. Kunst muß auch Irritation stiften, Verwunderung auszulösen und Fragen aufwerfen, um nicht als Dekoration mit Alibifunktion zu verkommen. „Was soll das denn?“ fragen sich die Besucher. Nur so kommen Fragen auf. Nicht, wenn die Erwartungshaltung sofort befriedigt wird.
July 1999
Jean-Baptiste Joly, Direktor der Akademie Schloss Solitude, Stuttgart