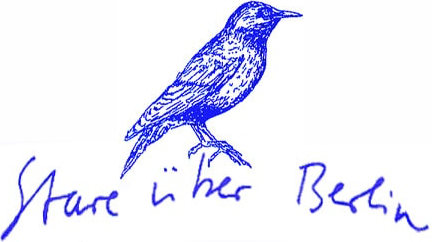Jacob Sello
Interview mit Tilman Küntzel im Rahmen einer Dissertation im Fach Systematische Musikwissenschaft an der Universität Hamburg.
Interview Tilman Küntzel am 23. Oktober 2007 erschienen in:
Die Klanginstallation – Ein interdisziplinäres Versuchslabor zwischen Kunst Musik & Forschung. Verlag Dr. Kovać, Hamburg, 2014
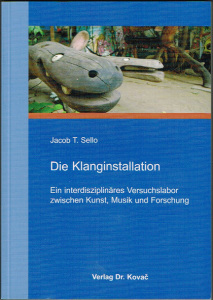
Ich verstehe Klanginstallation als Schnittstelle zwischen verschiedenen Kunstgattungen. Wo liegt dein Schwerpunkt und was ist dein persönlicher Hintergrund?
Der Unterschied der Klanginstallationen zur Hörsituation im Orchester zum Beispiel beim Konzert ist der, dass der Betrachter sich frei im Raum bewegen kann. Die Ereignisse sind dabei im Raum angeordnet und der Betrachter kann sich das Ereignis durch seine eigene Bewegung im Raum erschließen. So verstehe ich die Klanginstallation. Ich komme ja aus der Bildenden Kunst, habe mich auch mit Zeichnungen beworben und bin letztlich dahin gekommen, den Betrachter in einem Raum mit meiner Arbeit zu vereinnahmen, aus der Beobachtung heraus, dass die Auseinandersetzung mit sogenannter Flachware, also mit Zeichnungen oder Bildern an den Wänden eine sehr oberflächliche ist. Der Betrachter hat da viel mehr die Möglichkeit, einfach darüber hinwegzusehen oder dran vorbeizugehen und sich nicht so intensiv damit auseinanderzusetzen, als würde er in einem Raum stehen, wo um ihn rum sehr viel passiert. Und das war eigentlich der Ansatz, wie ich dazu gekommen bin, den ganzen Raum zu bespielen, anstatt die Arbeit auf einem Blatt Papier zu fixieren.
Wieso entscheidest du dich für Klang als künstlerisches Material, was zeichnet Klänge aus?
Sie berühren einen tiefergehend, würde ich sagen. Wenn eine künstlerische Arbeit eine poetische Aussage treffen will, ist Klang ein Medium, das sehr direkt die Emotion anspricht. Das hat natürlich auch mit meiner Sozialisation zu tun. Ich komme aus einem musikalischen Elternhaus, habe mich als Kind mit Vorliebe unter dem Flügel aufgehalten. Und das sind so Eindrücke, die einen glaube ich sehr prägen. Also man hat da schon so eine auditive Sensibilität mitbekommen, vom musikalischen Elternhaus. Darüber hinaus musste ich natürlich auch Instrumente lernen. Dieser Drill hat mich dann nicht zum Instrumentalisten werden lassen, aber wahrscheinlich doch zum experimentalen Klangkünstler in dem Sinne, dass ich gerade diese Bürgerlichkeit, Geige und Flöte als kleines Kind lernen zu müssen und mit der Familie Quintett, ein Teil des Familienquintetts sein zu müssen, ablehne. Es hat mich dahingebracht, dagegen zu rebellieren und mit Klangkollagen dagegenzusteuern. Aber die Sensibilität den Klängen gegenüber kommt bestimmt aus dieser familiären Situation.
Arbeitest du denn ausschließlich mit Klang?
Nein, keineswegs. Ich habe im Kunststudium sehr viel mit Video gearbeitet und dabei immer das Ziel vor Augen gehabt, eine perfekte Balance zu finden zwischen visuellen Bewegungen und auditiven Eindrücken, also Visuellem und Auditivem. Gerade mit dem Medium Film oder Video geht das sehr gut, weil eben, das kennen wir ja alle von herkömmlicher Filmmusik, wenn man da die Klänge, die Musik austauscht, interpretiert sich das Bild auf eine völlig unterschiedliche Weise. So wie jeder visuelle Eindruck, den wir von unserer Umgebung haben, in der wir uns befinden, sich verändert, sobald der Klang sich verändert. Also wenn wir in einem Café sitzen, wie jetzt, und es wäre eine andere Musik, eine andere Akustik im Raum, hätten wir einen anderen Eindruck von dem Ort. Wäre mehr oder weniger gemütlich vielleicht, würden wir uns hier mehr oder weniger wohl fühlen. Und so ist ja eben die ganze synästhetische Wahrnehmung aufgebaut, dass alle diese Sinneseindrücke zusammen einen Charakter bilden von dem, was wir wahrnehmen, was wir empfinden. Und darüber ist der Klang ein ganz wichtiges Medium, was relativ stark in Vergessenheit geraten ist, dass diese synästhetische Wahrnehmung eigentlich unseren Alltag, unsere Wahrnehmung der Welt bestimmt. Und das habe ich eigentlich für mich sehr früh während des Kunststudiums entdeckt, und arbeite seither dementsprechend.
Gibt es performative Aspekte in deinen Arbeiten?
Immer wieder eigentlich gerne. Es ist ein eigenständiges Medium, Dinge zur Aufführung zu bringen. Und das ist auch eine sehr spannende Situation, weil der Betrachter dann relativ stark am Sitz gefesselt ist. Er muss das Stück von vorne bis hinten durchhören. Man kann also eine Dramaturgie aufbauen, die man vielleicht in einer Klanginstallation so nicht dem Betrachter auferlegen kann. Weil er immer noch frei ist, sich in diesem Raum selbst zu bewegen, er kann sich auch verweigern. Und in einem Konzertsaal oder bei einer performativen Aufführung ist das nicht so leicht möglich. Da muss er wirklich vom Anfang bis zum Ende sitzen bleiben oder das über sich ergehen lassen und hat dann eben die Skulptur als solche von vorne bis hinten erlebt und das ist manchmal befriedigender, als eine Intervention im Raum, die man genauso gut überhören kann, wenn man nicht gerade darauf sensibilisiert ist und begreifen will, was da vor sich geht.
Und was reizt dich speziell an der Klanginstallation?
Die Verwirrung. Verwirrung stiften, also gewohnte Sinneserfahrungen zu irritieren, mit Irritationen zu arbeiten und mit Fehlerhaftigkeiten. Ich finde es spannend, die Leute aus ihrer gewöhnlichen Erwartungshaltung ein bisschen herauszuschütteln, um dadurch auch Aufmerksamkeit und Wahrheiten herauszukitzeln, etwa aus Orten. Also Räume in ihrem Charakter zu begreifen, mit der Akustik des Raumes zu arbeiten und darüber den Raum neu zu definieren.
Oder in seinem Wesen ganz konsequent zu bestimmen, zu definieren. Das ist spannend, und umso komplizierter, je ungewöhnlicher der Ort ist. Das wurde, glaube ich, gerade in den 90er, 80er, 90er-Jahren sehr viel praktiziert, dass man sich speziell ungewöhnliche Orte gesucht hat. Also irgendwelche Lagerhallen oder Baustellen etc. – also ungewöhnliche Orte, die für die Kunst eigentlich nicht prädestiniert sind. Aber gerade dort mit dem Charakter dieser ungewöhnlichen Orte zu intervenieren ist, meiner Meinung nach, eine sehr klassische Rahmenbedingung für Installationen.
Gibt es bestimmte Künstler oder Bewegungen in der Kunst, die dein Schaffen beeinflusst haben, vielleicht irgendeine Traditionslinie in der du dich siehst?
Ich persönlich bin in meinem Kunststudium sehr viel mit Fluxus, mit Protagonisten aus der Fluxus-Szene in Berührung gekommen. Und Cage ist ja auch einer, der wahrscheinlich von jedem zitiert wird, als jemand, der wichtig war, der sehr viele Aspekte thematisiert hat, der auditiven und audio-visuellen Wahrnehmung. Klar, Cage und andere aus der Fluxus-Bewegung, auch Literaten, affirmative Künstler, Happening und so weiter… das hat mich ziemlich geprägt, glaube ich, ja. Und darüber hinaus natürlich Alvin Lucier oder Nam June Paik. Die waren schon in meinen Anfangsjahren im Studium wichtige Persönlichkeiten.
Kunst und Technologie stehen im 20. Jahrhundert in enger Beziehung zueinander. Besonders auch in Hinblick auf Klangkunst. Welchen Stellenwert hat Technologie in deinen Arbeiten?
Also ich versuche keine Computer zu verwenden. Ich mag es ,mit ganz durchsichtigen Strukturen zu arbeiten. Also ich versuche, so wenig Technologie wie möglich einzubauen, aber doch mit Dingen, die unseren Alltag bestimmen. So im Sinne von Nam June Paik zum Beispiel, der einfach schon ganz früh Circuit Bending betrieben hat, etwa mit Fernsehgeräten. Alltagsgegenstände zu verändern und neu zu definieren und neue Funktionsweisen von gewöhnlichen technischen Gerätschaften, die unser Leben bestimmen, einzusetzen, finde ich sehr reizvoll. Das finde ich reizvoller als jetzt eine neue Ästhetik zu entwickeln, die nur mit einer bestimmten innovativen Technik möglich ist. Das interessiert mich weniger, weil ich dann immer hinter der technischen Entwicklung hinterher laufen würde. Ich würde immer Opfer der technischen Erneuerung sein, die nicht meine Erfindung ist und die ich nicht selber definieren kann, wo man immer ein Stück hinterherhinkt. Gerade auch, weil ein Großteil der Unterhaltungselektronik zum Beispiel aus der Weltraum- oder aus der militärischen Forschung kommt und immer in einem bestimmten Stadium der Kunst zur freien Verfügung übergeben wird. Wenn man das reflektiert, ist man ja eigentlich in einer schlechten Position, weil man davon eigentlich fremdbestimmt wird, in seinem kreativen Schaffen.
Entwickelst du denn für jedes Projekt dann eigene Verfahren, eigene Techniken?
Nicht unbedingt, nein. Also ich habe so meine quasi „Erfindungen“ oder meine Mechanismen, die dann durchaus in verschiedenen Varianten, an verschiedenen Orten immer wieder zum Einsatz kommen. Das hat wohl auch mit so einem persönlichen Profil zu tun, das man sich auferlegt, wie ein Maler auch vielleicht durch einen bestimmten Pinselstrich erkennbar ist. Auch wenn er zig verschiedene Motive damit gestaltet, bleibt er doch immer erkennbar, an einer bestimmten Handschrift. Und so habe ich da auch meine individuelle Handschrift. Das geht bis hin wie man die Kabel verlegt, ob das jetzt sichtbar ist oder nicht, ob man viel mit Lautsprechern arbeitet oder eben indirekte Beschallung betreibt. Aber es hängt immer von den Orten ab, welcher Mechanismus zum Einsatz kommt. Und das können auch im besten Fall wirklich neue Erfindungen sein, wenn Systeme, die ich schon habe, nicht in Frage kommen, weil es in dem Ort einfach nicht stimmig wäre oder so. Dann kommt es natürlich immer wieder zu Neuerfindungen. Das muss auch so sein, sonst würde man mit einem bestimmten Instrumentarium sein Leben lang umgehen, und das wäre dann auch irgendwann ausgereizt und langweilig.
Könntest du mal ein Beispiel für so eine Erfindung nennen?
Ja, ich habe z. B. eine Serie gemacht, wo ich also natürliche Lichtintervalle aus Lichterketten benutze. Die erzeugen so ein zufälliges Lichtintervall, dass ich dann hörbar gemacht habe. In den Stromkreislauf habe ich dann anstatt der Leuchten verschiedene elektrische Elemente eingelötet, die so aleatorische Rhythmen generieren. Ich habe da also verschiedenste Lichterketten bis hin zu defekten Neonröhren verwendet, um eben solche aleatorischen Rhythmen zu erhalten, die z. B. auch beim Starten einer Leuchtstoffröhre entstehen. Daraus ist eine Serie von Installationen entstanden, mit denen ich seit längerer Zeit arbeitete. Es geht also um die Hörbarmachung von Lichtintervallen aus stummen Lichterzeugern.
Also entstehen deine Klänge meistens aus so einer Zweckentfremdung? Würdest du dich denn selbst als Bastler bezeichnen?
Ah, ich hasse das (lacht). Ich mag das gar nicht. Aber klar, man experimentiert. Und dieses Experimentieren hat wohl etwas vom Basteln, wenn man also Dinge auseinander nimmt und zweckentfremdet. Dieses „Circuit Bending“ ist glaube ich so ein Bastlermetier, ja.
Und diese Erfindungen ja auch…
Ja, genau, man muss ja irgendwie dazu kommen und experimentell damit umgehen und das hat wahrscheinlich mit Bastelei zu tun. Das hat aber so eine Ebene von Hobbyismus. Deswegen mag ich diesen Begriff nicht so unbedingt.
In so einem Bereich zwischen High-Tech und Low-Tech, wo siehst du dich da?
Eher in der Low-Tech Ecke.
Aha. Nächste Frage: Im Feld der Klanginstallation erscheint die Unterteilung der Künste in Raum- und Zeitkunst, wie sie ja bereits im 18. Jahrhundert von Lessing vorgebracht wurde, als weitgehend überwunden. Welchen Stellenwert hat denn Raum in deinen Arbeiten? Was für Räume gibt es überhaupt und wie gehst du damit um?
Ich gehe sehr bewusst mit den Räumen um, speziell mit der Akustik. Es gibt ja viele Musiker, die kommen in Räume und sagen „oh, das ist aber eine schwierige, eine schlechte Akustik hier“. Gerade wenn es einen langen Nachhall gibt, wird das oft so gesagt. Aber das gilt für mich eigentlich nicht, denn mit jedem Raum, mit jeder Raumakustik kann man umgehen. Und speziell bei sogenannten schwierigen Räumen, in Kirchen zum Beispiel oder in Ausstellungsräumen, die also kaum Geräuschschluckende Elemente aufweisen, also sehr hallig sind, ist es sehr reizvoll, damit umzugehen. Ich finde, man kann mit so einem Nachhall sehr gut arbeiten. So eine Raumakustik ist ja auch ein Klang generierendes Element, das ich, wenn ich Arbeiten für bestimmte Orte entwikkele, einbeziehe. Wenn ich z. B. hier [im Cafe] eine Installation machen sollte und wüsste, ab und zu schaltet sich diese Kaffeemahlmaschine ein, dann ließe sich das bestimmt irgendwie integrieren. Es wäre dann ein Teil des Konzepts, damit umzugehen, so dass es nicht unbedingt ein Störfaktor wäre, sondern einfach ein Teil der Arbeit. Insofern ist für mich also der Umgang und die Recherche über den Raum, in dem ich eine Arbeit realisieren kann, sehr wichtig. Also das fängt mit der Bemessung des Raumes an und mit der Frage, wie sich der Betrachter in diesem Raum verhält, wie er sich durch diesen Raum bewegt, sich die Akustik in verschiedenen Abschnitten des Raumes verändert und so weiter.
Ich arbeite ja auch nicht so, dass ich im Atelier, also im sterilen Raum meine Arbeit entwickele und mir dann den Ort suche, wo die Arbeit funktioniert, sondern ich fange eigentlich erst an, die Arbeit zu konzipieren, wenn ich weiß, wofür, in welchem Kontext die Arbeit gezeigt wird. Und das kommt mir jetzt zugute, weil immer mehr Kuratoren Themen vorgeben. Und da ich irgendwie die Auseinandersetzung mit Räumen gewohnt bin, fällt es mir auch nicht besonders schwer, mich auf bestimmte Themen einzulassen, während viele Kollegen Schwierigkeiten damit haben, weil sie dann in ihrem Fundus kramen müssen und irgendwas aussuchen, was da passt. Also die Recherche ist für mich ein großer, ein wichtiger Teil, bevor ich mich festlege, wie diese Arbeit funktionieren könnte. Und die Recherche über den Raum, über den Kontext, bis hin zum Kontext des Festivals, der Ausstellungsmacher, woher kommen die, was wollen die von einem, was erwarten die und das sind alles so Parameter, die eigentlich für mich eine große Rolle spielen, bis ich mich schliesslich auf eine bestimmte Form der Installation festlege.
Welche Rolle spielt Zeit in deinen Arbeiten? Gibt es bei Dir so was wie eine musikalische Dynamik, im Sinne einer Dramaturgie oder Komposition?
Sicher. Immer, wenn etwas klingt oder mit Lichtbewegungen funktioniert, ist der Zeitparameter da und nicht wegzudenken. Ich persönlich mag Längen sehr, sehr gerne. Für mich kann eine Arbeit sehr langatmig sein. Ich finde es wichtig, diesen Punkt zu überwinden, wo Langeweile entsteht. Ich finde es sogar immer spannend, Langeweile zu erzeugen, weil wenn man das ausgesessen hat, fängt es dahinter an, spannend zu werden. Zum Beispiel „Empty Words“ von John Cage. Drei Stunden lang – er sitzt da und bildet eigentlich nur Laute. Nach einer halben Stunde merkt man irgendwie „oh, da passiert ja jetzt nichts mehr Großartiges“. Wenn man dann aber dennoch wirklich bis zum Ende sitzen bleibt… Die Wenigen, die dann noch im Zuschauerraum sitzen, die sind dermaßen vereinnahmt… Das hat ja schon etwas Meditatives. Das finde ich einen sehr spannenden Moment. Wir sind ja auch geprägt von dieser „MTV drei Minuten Einheit“. Da sollte man sich aber nicht drauf einlassen, nicht alles nur auf die Hörgewohnheit dieser schnelllebigen Zeit ausrichten. Das selektiert natürlich auch die Zuschauerzahl. Das finde ich aber auch gut. Viele lassen sich nicht drauf ein, kriegen Eindruck innerhalb von ein paar Minuten, haben aber das Eigentliche nicht begriffen. Das ist dann auch okay. Dafür gibt es dann aber auch diejenigen, die das aussitzen und die profitieren davon. Das ist so eine natürliche Selektion, die ich gerne in Kauf nehme.
Was inspiriert dich denn zu deinen Arbeiten und was motiviert dich? Wo kommen die Ideen her?
Das ist schwierig zu beantworten. Einerseits die Vorgaben, die gemacht werden, die Strickmuster, die von Kuratoren, die irgendwelche Festivals ausschreiben, vorgegeben werden. Andererseits ist ja die Rezeption von Kunst und Musik heutzutage ein Thema, das ich gerne gerade zum Beispiel mit diesen Längen konterkariere, sich also nicht darauf einzulassen, mit den Erwartungshaltungen zu brechen und mit den gewohnten Hörgewohnheiten zu spielen. Schon die Rezeption von Kunst und Musik ist ein Thema. Und auch einfache Systeme erfinden, wie diese Licht-Ton allegorischen Objekte. Das sind ja auch kleine Apparate, selbst spielende Instrumente quasi. Das ist ein Thema. Oder einen Raum als selbst spielendes Instrument zu konzipieren ist ein Thema, ja, im Sinne von Bastlertum, von Erfindergeist.
Welche Aspekte sind dir in der Umsetzung wichtig? Also was sind die zentralen Gesichtspunkte in der Gestaltung? Legst Du Wert auf interaktive oder funktionale Aspekte? Oder Ästhetische?
Also weniger Interaktion, da bin ich nicht so ein Freund von, dass jetzt der Betrachter selbst Protagonist ist und mit seinen Bewegungen Dinge auslöst. Ich möchte eher gewohnte Rezeptionsmechanismen aufbrechen und provozieren. Etwa durch Längen Gewohnheitsmuster zu konterkarieren, das finde ich spannend. Und ich habe eine Weile mit gefundener Ästhetik gearbeitet, das hat aber nicht gut funktioniert. Ich habe zum Beispiel Kitschobjekte verwendet, weil die ein Lichtintervall aufwiesen, das ich dann in auditive Signale umgesetzt habe, dabei habe ich dann aber nie diese Fundstücke verändert, habe sie also als Zitat, als visuelles, ästhetisches Element so belassen und gezeigt. Das ging aber eigentlich immer nach hinten los, weil die Macht der Bilder doch so stark ist, dass diese Kitsch-Ästhetik immer im Vordergrund blieb und nicht als „Object Trouvé“ begriffen wurde, als Fundstück. Deswegen bin ich im Moment eigentlich in so einem Stadium, dass ich doch wieder gestalten möchte und regelrecht Objekte, wie Skulpturen bauen möchte, die auch vielleicht eine galeriefähige Ästhetik aufweisen. Darüber denke ich zur Zeit nach. Ich möchte ja auch etwas erreichen, auch durch Galerien ein Verbreitungsfeld finden und nicht nur auf Experimentalfestivals ausstellen, irgendwie von einem Festival zum anderen tingeln, sondern ich möchte mit meiner Kunst auch Geld verdienen – und ja, ein bisschen muss man da schon Kompromisse machen, im Alter. [Gelächter] – Ja, nach 17 Jahren professioneller Praxis kommt man zu so einem Punkt, vielleicht.
Und die Atmosphäre des Raumes? Spielt das bei Dir eine Rolle? Ist das etwas, was du gezielt gestaltest?
Ja, die sind immer ein wichtiger Bestandteil. Aber ich gestalte weniger die Atmosphäre, als dass ich die schon existierende, vorgefundene Atmosphäre eines Ortes irgendwie aufnehme und meine Arbeit darin einbette. Und umso besser diese Einbettung ist, desto unmerklicher wird die Intervention. Das ist auch ein Punkt, wo ich manchmal denke „oh je, jetzt war ich schon wieder zu genau, jetzt bemerkt es wieder keiner“. Es wirkt dann so, als wäre es immer da gewesen. Und das spricht dann eigentlich dafür, dass ich eine gute Arbeit gemacht habe, aber sie ist dann so gut, dass sie leider nicht mehr bemerkt wird. Die Arbeit verbindet sich dann zu stark mit den Aspekten des Raumes, ist zu sehr integriert, so dass sie zu wenig konterkariert und aufbricht. Also perfekt wäre so ein Mittelmaß. Ich will also schon mit der Atmosphäre des Ortes oder der Umgebung arbeiten, dabei aber doch noch eine kleine Provokation, kleine Stolpersteine drin haben. Das ist wahrscheinlich geschickter, als sich zu sehr auf die Raum- und Umgebungsatmosphäre einzulassen.
Entwickelst du für jeden Ort ein neues, ortsspezifisches Konzept?
Ja, auf jeden Fall. Wobei es nicht ausgeschlossen ist, dass Systeme, die ich schon in anderem Kontext verwendet habe, da wieder ihren Platz finden. Also das kann durchaus sein. Das ist ja wie so eine Art Instrumentarium, was man zur Verfügung hat und man sucht aus, was passen könnte. Wenn nichts passt, dann entstehen neue Systeme. Das ist eigentlich am Spannendsten.
Gibt es in deiner Arbeit so etwas wie ein Leitmotiv, ein Thema, das sich durch verschiedene Arbeiten zieht?
Ja, schon. Die Synästhesie von Audio-Visuellem. Das ist eigentlich immer mein Thema gewesen und ist für mich bis heute spannend. Gerade in dem Bereich werden ja zur Zeit so viele neue Erkenntnisse gewonnen. Etwa durch die Computertomographie wird gerade sehr viel über neuronale Mechanismen der Wahrnehmung herausgefunden. Das ist so ein Feld, das mich gerade sehr interessiert, die Frage, wie diese synästhetische Wahrnehmung funktioniert. Ich komme immer mehr dahin zu glauben, dass die Idee, eine perfekte Balance zu erzielen, von einer künstlerischen Setzung ausgeht. Eine perfekte Balance zwischen Auditivem und Visuellem kann es eigentlich gar nicht geben, weil jeder eben auf seine Weise konditioniert ist. Also ein Fotograf hat eine ganz schlechte akustische Wahrnehmung. Und ein Musiker, ein Komponist hat eine ganz schlechte visuelle Wahrnehmung. Und wenn man beides in einem Ort verbindet, dann interpretieren diese Gruppen eine Situation auf völlig unterschiedliche Weise. Deswegen liegt es nicht an mir, eine perfekte Balance herzustellen, sondern eigentlich an dem Betrachter. Das finde ich irgendwie ein spannendes Ding. Da sind dann eher die Rezeptionsmechanismen das Thema. Man stößt also etwas an und untersucht, was passiert bei dem Betrachter. Das halte ich für eine spannende Auseinandersetzung. Der Betrachter wird dann in seiner Wahrnehmung hinterfragt.
Dann kommen wir jetzt auch gleich zum Publikum. Wo präsentierst du deine Arbeiten?
Ganz unterschiedlich. Sehr häufig auf Festivals, wo ein Spezialpublikum da ist. Installationen werden ja sehr oft als Rahmenprogramm von Musikfestivals präsentiert. Aber auch auf Videofestivals, wo ich eigenständige audio-visuelle Videoarbeiten präsentiere, bis hin zu Galerieräumen, also „White-Cube-Räumen“, die ganz neutral sind, wo ich Arbeiten zeige, die mit dem Raum relativ wenig zu tun haben. Das ist eben das Gute an diesen Künsten in den Zwischenbereichen, dass man da auf mehreren Hochzeiten tanzen kann, sowohl in Galerien als auch auf Musikfestivals oder Videofestivals. Oder auch auf rein elektroakustischen Musikfestivals mit auditiven Stücken, wo ja auch immer mehrkanalige Arbeiten, die dann im Raum platziert werden, präsentiert werden. Eigentlich kann ich alles das bedienen.
Ist das dann eine bestimmte Zielgruppe?
Es ist jeweils eine sehr unterschiedliche Zielgruppe, wobei ich auch sehr gerne die Stimmen und die Kommentare von absoluten Normalbürgern hören will, die jetzt kein Spezialpublikum sind, nicht selber Musiker oder Künstler sind, also der normale Bürger der Straße. Da habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass Präsentationen von „Leuten von der Straße“ sehr gut rezipiert wurden und sehr gut ankamen, von Kunstkritikern aber überhaupt nicht. Das finde ich sehr merkwürdig, kann ich auch irgendwie nicht erklären. Ich mag es nicht so sehr, zu so einer abgehobenen Elite zu gehören, ich bin gerne bodenständig und freue mich, wenn auch der normale Mensch von der Straße, der zufällig vorbeikommt und mal reingeht und mit so einem „Aha-Erlebnis“ herauskommt. Deswegen auch der Umgang mit Fundstücken, mit Alltagsgegenständen, die neue Wahrnehmungsebenen auftun von Dingen, die für Normalleute ganz normale Gegenstände des Alltags sind. Kunstkritiker würden das als Spielerei oder als Bastelei bewerten. Aber da ist eben ein sehr breites Spektrum möglich und ich bin nicht jemand, der einmal eine Erfindung gemacht hat, um die dann so lange zu wiederholen, bis wirklich der letzte Kunstkritiker begriffen hat, dass diese Arbeit jetzt mit meinem Namen zu verbinden ist. Das machen ja auch einige Künstler, dass sie einmal eine Form für sich entdeckt haben und die dann immer, immer wieder in verschiedensten Varianten präsentieren, so dass man sofort erkennt „ah ja, das ist der Künstler“. Das ist vielleicht eine sehr professionelle Strategie, die mir aber nie besonders gefallen hat. Ich finde es für mich lebendiger, wenn ich verschiedene Formen präsentiere, die nicht sofort assoziierbar sind mit meiner Person. Wobei ich deswegen einfach noch viel mehr zeigen muss als andere, bis dann doch wieder der rote Faden erkennbar wird.
Und welche Rolle spielt der Rezipient in der Arbeit? Oder für die Arbeit?
Na ja, da ich es eigentlich vermeide, Systeme zu entwickeln, die interaktiv funktionieren, die also irgendwie mit der Präsenz des Betrachters funktionieren, spielt der Rezipient eigentlich keine besonders große Rolle. Er kommt und sieht das oder auch nicht.
Ist es dir wichtig, was er davon hält? Redest du mit den Besuchern?
Ungern. Ich bin auch ungern präsent, wenn irgendwas von mir gezeigt wird.
Dann beobachtest du die Besucher auch nicht?
Naja, beobachten schon eher. Aber ich will nicht unbedingt daneben stehen und irgendwas erklären müssen. Das finde ich ganz furchtbar, das nimmt dem Ganzen viel Wind aus den Segeln, sozusagen. Die eigene Sinngebung leidet darunter, die individuell in jedem Kopf und für jeden ganz eigenständig abläuft. Jeder entwickelt ja seine eigene Assoziationskette und man hört da manchmal die unglaublichsten Dinge, an was irgendeinen Betrachter das erinnert. Das ist dann schon spannend zu hören. Und da denke ich auch, eine Arbeit ist umso besser, je mehr freie Assoziationen sie zulässt. Und da unterscheide ich mich wahrscheinlich auch von der klassischen Galeriekunst, die so eindeutig und klar gestrickt ist, dass sie eigentlich nur noch für den Galeristen einen Verkaufswert darstellt und wenig freie Assoziationen ermöglicht. Deswegen, denke ich, bin damit zwar nicht kommerziell erfolgreich, aber doch noch wesentlich lebendiger.
Gibt es irgendwas, was der Rezipient mitnehmen soll, irgendwas, was du vermitteln willst?
Eigentlich nicht. Also ich weiß, das ist Kultur und Kultur hat die Funktion, zu entspannen, so dass der Betrachter sein Alltagsleben für den Moment vergessen kann. Ich möchte mit meinen Arbeiten auch nicht unbedingt provozieren und Leuten irgendwie einen schlechten Eindruck, schlechtes Gefühl vermitteln. Da bin ich schon ganz konservativ, in dem Sinne, dass man davon einfach eine gute Erfahrung mit nach Hause nehmen soll. Eine gute Poesie soll eigentlich rüberkommen, die einen mit einem positiven, warmen Gefühl entlässt aus der Installation. Das finde ich schon erstrebenswert. Ja. Also eine sympathische Kunst. Das finde ich netter, also Provokation, speziell in Klanginstallationen.
Interviewer: Kannst du oder könntest du von deiner Kunst leben?
Proband: Nein. Nicht wirklich. Also zur Hälfte vielleicht, ich muss aber immer noch was dazu haben, um einen bestimmten Lebensstandard zu haben, aus dem ich dann auch ohne Ängste meinen Tag begehen kann sozusagen.
Und würdest du gerne können?
Ja, auf jeden Fall, ja, ja. Diese ewige Armut ist sehr undankbar, weil man ja eigentlich eben das Leben der anderen Menschen bereichern möchte, also ja eigentlich eine soziale Leistung da vollbringt. Und das muss gefördert werden vom Staat, von Stipendien, etc. Ich habe schon einige Stipendien bekommen und das finde ich auch okay. Das muss geleistet werden irgendwie. Aber dennoch muss man als Selbstständiger ständig kämpfen. Es gibt keine Agentur, die einen protegieren würde, so wie es die für Bildende Künstler gibt. Oder Galerien, die sich für den Künstler einsetzen, so dass sich der Künstler wirklich in sein Atelier zurückziehen kann und eine Intensität in seinen Bildern aufbauen kann. Das fehlt irgendwie, müsste aber so sein, so dass es auch für Konzept- und Installationskünstler so etwas wie einen Galeristen gibt, der sich um diese Verwaltungsarbeit und Promotion kümmert. Ich glaube in dieser Medienkunstszene muss man Manager sein, muss man eigentlich alles mögliche sein, muss seine Steuererklärung selber machen, muss seine Krankenkasse irgendwie bezahlen. Also steuerlich zum Beispiel rutscht man in irgend so eine Kategorie des Hobbyisten, wenn man nicht ein bestimmtes Einkommen erzielt. Das ist so ein Korsett, das uns auferlegt wird. In diesem Beruf zu überleben, ist ziemlich schwer, ja, es ist schwer. Es gibt wirklich wenige, die das erreicht haben, sorgenfrei ihrer Kunst nachgehen zu können und sich nicht um diese ganzen verwaltungstechnischen und promotiontechnischen Aufgaben kümmern zu müssen.
Vielen Dank für das informative Gespräch.
PDF (Jacob Sello Interview Magisterarbeit 1997, 123 KB)