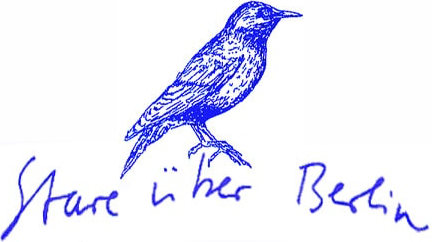Tilman Küntzel
Über die subjektive Wahrnehmung audiovisueller Klanginstallationen – Gedanken zur Neuroästhetik
Publikation in KunstMusik – Schrift zur Musik als Kunst
Heft Nr. 10 Frühjahr 2008

Thesis:
Das Gestalten von audiovisuellen Räumen ist ein undankbares Unterfangen wenn die Wahrnehmung einer multimedialen Setzung beliebig erscheint.
I
In meinen Installationen provoziere ich bewusst kognitive Dissonanzen, da für mich gerade in dem Zwischenbereich des Bekannten zum Neuen, also Unbekannten die Innovation liegt. [ Vgl. meine Installation Ein kleiner Rosengarten-Mercer Union, Gallery for contemporary Art, Toronto 1998] Jedoch bedarf es der Bereitschaft des Rezipienten, eine Neudefinition des Erlebten überhaupt zuzulassen. Ob die Bereitschaft dazu vorhanden ist, hängt sehr von der individuellen Prägung des Betrachters ab, insbesondere, da es sich um synästhetische Wahrnehmung handelt und wir bekanntlich unter Augen- und Ohrenmenschen unterscheiden.
Im Allgemeinen sucht der Mensch mit seiner natürlichen selektiven Wahrnehmung die als angenehm empfundene konsonante Kognition und versucht, die dissonante zu vermeiden. Er neigt dazu, einmal getroffene Entscheidungen zur Beurteilung des Erlebten beizubehalten. Neue Informationen, die zu der getroffenen Entscheidung in Widerspruch stehen, werden tendenziell abgewertet, während alle konsonanten Informationen tendenziell überschätzt werden. Erst wenn die durch die Dissonanz erzeugte innere Spannung zu groß wird, ändert der Betrachter die getroffene Entscheidung, um so Erfahrung und Entscheidung wieder zur Konsonanz zu bringen. [ Leon Festige, A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford (CA: Stanford University Press) 1957 ] Es bedarf also einer gewissen Toleranz, um ein dissonantes ästhetisches Erlebnis überhaupt zuzulassen. Dass Menschen aus vielfältigen, gelegentlich sogar widersprüchlichen Sinneseindrücken ein einheitliches Bild von der Wirklichkeit und den Objekten erzeugen können, hat bereits Immanuel Kant in seiner Kritik der reinen Vernunft angesprochen: „Der ich-denke-Gedanke muss alle meine Vorstellungen begleiten können“. Dieses „Ich denke“ (cogito) jedes Einzelnen ist die Macht, die alle Informationen zu einer Einheit verknüpft. Es erzeugt ein inneres „mitlaufendes Wirklichkeitsmodell“.
II
Man weiß bis heute wenig über die „Multisensorische Integration“, die Verschmelzung von Informationen verschiedener Sinnesorgane. Es ist einerseits sehr leicht, unsere Wahrnehmung zu täuschen, wie wir täglich erleben, wenn wir im Fernsehen schlecht synchronisierte Filme sehen. Man gewöhnt sich daran und glaubt es sofort – eben weil „sein darf was sein kann“. Andererseits fand man durch die Magnetresonanztomographie heraus, dass haptische Wahrnehmung, die mit auditiver Wahrnehmung einhergeht, bereits im auditorischen Kortex verarbeitet wird, also in einer tiefer liegenden Region als dem so genannten „Assoziationskortex“. Man vermutet, dass dies aus dem Grunde geschieht, dass „fehlerhafte“ Bilder, die nicht zur taktil-auditorischen Stimulation passen, bereits vor der multimodalen Integration „aussortiert“ werden [Vgl. C.Kayer, C.Petkov, M.Augath, N.Logothetis, Integration of touch and sound in auditory cortex. In: Neuron 48(2), 20 Okt. 2005] – ein Mechanismus zur Vorbeugung dissonanter Kognition.
III
Aber auch die vorhandene Bereitschaft zum Erkennen des Erlebten bedeutet noch lange nicht, dass die Intention des Machers mit der Erfahrung des Rezipienten korreliert. Die Subjektivität der Wahrnehmung liegt bereits in der Funktion des Sehens begründet. Seine Aufgabe besteht nicht in erster Linie darin, ein unverzerrtes Abbild der Umgebung zu erzeugen, sondern Muster zu analysieren und zu erkennen. Dabei werden auch ursprüngliche Bildinformationen stark verändert. Es wäre viel zu aufwendig, die Sinnesdaten in ihrer ursprünglichen Komplexität weiterzuverarbeiten. Daher werden sie in „Elementarereignisse“ zerlegt, um dann nach gehirninternen Prinzipien interpretiert, stabilisiert und zu einer schlüssigen Wahrnehmung wieder zusammengefügt zu werden. Das Nervensystem geht bei der Wahrnehmung selektiv, konstruktiv und auch interpretativ vor: Es wählt Wichtiges aus den vielen Informationen aus, die die Sinnesorgane aufnehmen, es ergänzt unvollständige oder uneindeutige Informationen und versucht sie – im Sinne des im Gehirn vorhandenen „Weltbildes“ richtig einzuordnen (Konzeptualisierung). Der Psychotherapeut Paul Watzlawick drückt es so aus: „ Wir bilden die Umwelt nicht in unserem Kopf ab, sondern „konstruieren“ sie selbst, im Sinne einer „wirklichkeitsschaffenden Fiktion“. Jeder Mensch schafft sich seine eigene Wirklichkeit, in der er sich zurechtfinden kann.
IV
Der Wahrnehmungsapparat eines Ausstellungsbesuchers, der eine Rauminstallation betritt, befindet sich sogleich in höchster Alarmbereitschaft. Auch wenn eine ausgeglichene Balance zwischen Auditivem und Visuellem angestrebt ist, werden diese Sinnesreize von jedem Betrachter in einer individuellen Balance wahrgenommen – je nachdem, welcher Sinn stärker trainiert ist. Das Auge ist in unserem gesellschaftlichen Umfeld zweifellos das dominante Sinnesorgan, obwohl sich der auditorische Kortex beim Fötus nach dem Tastsinn noch vor dem visuellen Kortex bildet und ein auditives Ereignis bereits nach 2 Millisekunden erkannt wird, wogegen das visuelle Ereignis dafür 17 Millisekunden braucht.[ Helga de la Motte-Haber, Lights & Sounds by Tilman Küntzel, in: Musikpsychologie, hrsg v. Helga de la Motte-Haber und Günther Rötter , Laaber 2005 (Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft Bd. 3)] Über den Sehnerv gelangt das Bild zunächst in den Thalamus, die wichtigste Umschaltstation im Hirn, die bereits als Filter fungiert und entscheidet, welche Informationen für den Organismus im Moment so wichtig sind, dass sie an die Großhirnrinde weitergeleitet und bewusst werden sollen (das Tor zum Bewusstsein). Danach kommt das Signal in der Amygdala an, wo es emotional bewertet wird. Für diese Einschätzung holt der Hippocampus Erinnerungen aus der Großhirnrinde, wobei er auch verschiedene Gedächtnisinhalte koordiniert und zusammenfügt, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten gewonnen wurden. Wird etwas Beängstigendes assoziiert, wird sogleich der Hypothalamus alarmiert, der mit der Hypophyse Stressreaktionen in Gang setzt. Herzschlag und Atmung werden beschleunigt und Schweiß produziert. Die Hirnrinde brütet derweil Fluchtmöglichkeiten aus. Dann erst gelangt das Bild in die Sehrinde und wird bewusst wahrgenommen: es ist nur eine Klanginstallation. [ Fehlalarm im Mandelkern, in: Die Zeit, 20. Dez. 2005 ]
V
Jeder Kreative kennt die Kommentare von Besuchern einer Vernissage, die ihre ganz eigene Interpretation des Erlebten schildern und dem Macher die Absicht der eigenen Arbeit erklären. In der Rezeption medialer Anordnungen führt der Drang nach konsonanten Informationen auch dazu, auf Kosten der ästhetischen Erfahrung nur mehr die mediale Funktionsweise der Arbeit zu untersuchen und als Konsonanz abzuhaken,
bevor überhaupt die poetische Absicht erkannt wird. Um dem entgegen zu wirken, habe ich stets auf den Einsatz von Computern verzichtet und vielmehr elektronische Elemente auf Low-Tech-Basis eingesetzt, die, wie Kabelwege, sichtbar im Raum Teil der ästhetischen Inszenierung waren.[ Siehe auch die Arbeiten von Ulrich Eller.]
Transparenz, dachte ich, würde diesen anscheinend zwanghaften Sinnfindungsprozess abkürzen, sodass der Betrachter schneller zu der ästhetischen Erfahrung findet. Jedoch ging dieses Kalkül nur selten auf. Ist die Technik versteckt, wird sie gesucht. Ist sie da, wird sie untersucht und mit dem Eigenen verglichen. Dem, was sie tut, wird dann kaum noch Beachtung geschenkt.
Ich war immer der Meinung, dass eine Arbeit gut ist, wenn sie die verschiedensten Interpretationsmöglichkeiten zulässt. Sie wird dadurch aber auch beliebig, was mich zunehmend stört. Oft wird sie auch schlicht als „Behübschung der Welt“ [ Hans-Werner Heister, Klang?Kunst? – über mimetische Zeremonien, die Behübschung der Lebenswelt und den Terrorismus der Klänge. In: Neue Zeitschrift für Musik 2 (2004), 28 f. ] angesehen, was mich noch mehr stört. Vielleicht ist das der Scheideweg, an dem sich das Genre der „Klangkunst“ teilt zwischen der räumlichen Inszenierung von Musik in der Tradition abendländischer Musik und dem Umgang von Klang als skulptural-statisch-architektonisches Material der Bildenden Kunst. [ siehe Bernhard Leithner Interview zur Ausstellung in Berlin, Hamburger Bahnhof Jan.- März 2008 ]
VI
Meine ersten Klangobjekte hatte ich „Synästhetische Objekte“ genannt. [ Vgl. Der gute Ton zum schönen Bild, Kunsthaus Hamburg 1989] Es handelte sich um Allegorien, wie eine Schreibtischlampe, deren Reflektor ein Lautsprecher war. Drückte man den Schalter, ertönten Schreibgeräusche. Oder eine Hängelampe, deren Reflektor ebenfalls aus einem Lautsprecher bestand, der die Frequenz von Strom, also etwa 50 Hz hörbar werden ließ. Schon der Titel deutet auf eine Wechselbeziehung hin, um die es mir hier ging (denn Objekte können nicht synästhetisch sein, vielmehr deren Wahrnehmung im Wechselspiel von Erwartung und Assoziation). Das war ein spielerischer Ansatz, der auf ein Schlüsselerlebnis zurückgeht, das ich als Jugendlicher mit 15 beim Hören von Musik unter Einfluss von Haschisch erfahren hatte. Vor meinem inneren Auge spielte sich ein Ballet von weißen Punkten auf schwarzem Grund ab, die zu der Musik von Tubular Bells von Mike Oldfield tanzten. Es waren ca. 30-50 Punkte, die 1:1 zur Musik metrische Formationen bildeten und in ihrer Choreographie die Dynamik und Dichte der fortlaufenden Musik darstellten. Es war ein so wunderbares Erlebnis, dass ich noch währenddessen hoffte, es würde nie vorübergehen.
VII
Tatsächlich ist die Fähigkeit, Töne als Formen oder Farben zu sehen (Audition colorée) oder Geschmack farbig wahrzunehmen, kein pathologisches Phänomen. Vielmehr sind die Sinne im Säuglingsalter des Menschen noch vermischt. Beim Erwachsenen tritt dies dann normalerweise nicht mehr auf. Ausnahmen sind Synästhetiker. Untersuchungen mit Kernspintomographen zeigen, dass bei diesen Ausnahme-Menschen beim Hören auch der visuelle Kortex aktiv ist. [ Erforscht von Hinderk Emrich an der Medizinischen Hochschule Hannover ] Darauf beruhend etablierte sich in den 70er Jahren das Farbglockenspiel für Kinder im Vorschulalter. Die Farb-Klang Analogie sollte hier das Erlernen der Tonleiter erleichtern – vorausgesetzt, die Pädagogen ordnen den Klangstäben die „richtigen“ Farben zu. Dies wiederum kann ein weiteres Phänomen verursachen, das nicht direkt in den Bereich der Synästhesie fällt: Die so genannte „assoziative Pseudosynästhesie“. Hier gehen die Forscher davon aus, dass die Betroffenen in der Kindheit gelernt haben, Buchstaben mit Farben zu verknüpfen, was ihnen synästhetische Wahrnehmungen ermöglicht. Die Voraussetzung sei ein aktiver Lernvorgang. [ Welche Farbe hat der Montag?. Hrsg. v. Hinderk M. Emrich, Udo Schneider, Markus Zedler. Stuttgart 2002 ]
VIII
Was macht also die Klangkunst? Die Welt „behübschen“ mit der Simulation von synästhetischen Erfahrungen? Bereits Charles Baudelaire hat in seinen Gedichten die Entsprechung von Tönen, Gerüchen und Farben bewusst eingesetzt. Er entwickelte den Gedanken, dass Sinne ineinander übersetzt werden können. Der Psychologe Robert D. Melara nennt es „intermodale Analogie“. Alexander Skrjabin komponierte 1919 die Synästhesie-Sinfonie Prometheus für Orchester, Piano, Orgel und Chor, in der eine Lichtorgel zum Einsatz kommt. Die Oper Der gelbe Klang (1912) von Wassily Kandinsky war eine spezielle Mischung aus Farbe, Licht, Tanz und Ton. Oliver Messiaen beschreibt visuelle Eindrücke, die sich mit der Musik bewegten: „sanfte Kaskaden von blau-orangefarbeben Akkorden“. Das erste Farbklavier erfand der Jesuitenpater und Mathematiker Louis Bertrand Castel um 1725, über das Georg Phillipp Telemann 1739 in seiner Beschreibung einer Augen-Orgel oder das Augen-Clavicimbels, so der berühmte Herr Pastor Castel erfunden berichtete. [ Zitiert aus: Musikalische Strukturen in der Kunst des 20. Jahrhunderts. In: Vom Klang der Bilder, hrsg. von Karin v. Maur. München 1985 ]
IX
Aber keine diese Ambitionen hat es weit gebracht, bis auf die Lichtorgel in den Diskotheken vielleicht, was für mich darauf hin deutet, dass die Voraussetzungen für eine einheitlich-ganzheitliche Wahrnehmung nicht vorhanden sind. Allein schon die Linkshändigkeit eines Rezipienten sorgt für eine Wahrnehmung der Welt, die sich von der der Rechtshänder unterscheiden muss. Dadurch, dass bei Linkshändern die rechte Gehirnhälfte dominiert, sind die hier untergebrachten Funktionen stärker ausgeprägt – wie zum Beispiel die räumliche Vorstellung, die konkrete oder geistige Konstruktion des Raumes, den man aus verschiedenen Perspektiven betrachten kann. In der linken Hälfte, die bei Rechtshändlern dominant ist, werden vornehmlich symbolisch-analytische Informationen verarbeitet, wie Sprache oder die Bedeutung von Symbolen und Abbildungen. In einer Seminarsarbeit beschreiben Schüler des Albert-Schweizer-Gymnasiums Sömmerda diese Unterschiede ganz vorzüglich: „Der grundlegendste Unterschied zwischen den Gehirnhälften ist, dass die linke Hemisphäre, welche die sensorisch und motorisch rechte Körperhälfte kontrolliert, das analytische, logisch-sprachliche Denken beherrscht und aufeinander folgend operiert, unterdessen die rechte Hemisphäre das synthetische, ganzheitliche Denken favorisiert, das beziehungsreich und gleichzeitig ist.(…) Besonders interessant ist die rechte Hemisphäre hinsichtlich ihrer Fähigkeit für Melodie- und Tonhöhengedächtnis. Durch ihre Aktivierung werden Laute besser erkannt und wahrgenommen und Melodien sehr genau wiedergegeben. Ebenfalls sollen sprachbeeinträchtigte Menschen mit Schädigungen an der linken Gehirnhälfte besser und problemloser singen und sprechen können als ohne diese Schädigung.“ [Linkshändigkeit und Umschulung, vgl.: www.linkshaender.de/s_000_knowledge.html?lk=608 ]
Im täglichen Leben gehen wir in der Regel von einem Weltbild aus, das Philosophen oft als „naiven Realismus“ bezeichnen. Hierbei setzen wir stillschweigend voraus, dass die äußere Wirklichkeit genau so beschaffen ist, wie wir sie wahrnehmen. Aber schon die Amygdala steuert die Wahrnehmung individueller emotioneller Erinnerungen, während der Hippocampus übereinander geschichtete Erinnerungen und Ereignisse aus der Großhirnrinde hervor holt. Denn diese schichten sich vom Fötusalter an mit fortschreitender Zeit übereinander und bilden so einen individuellen Kosmos.
Ich stelle mir diese Erinnerungen als Neuronen-Cluster vor, die wie ein Netz in den Großhirnrinden abgelegt werden. Darin enthalten sind auch Botenstoffe für die emotionale Bewertung. Legen sich diese Patterns übereinander, beeinflussen sie sich gegenseitig oder verschmelzen miteinander. An Stellen mit deckungsgleichen Mustern können Phobien oder Vorlieben entstehen. Die tiefer liegenden Erinnerungen können zerfallen und Fragmente aus verschiedenen Zeitzonen (z.B. jährlich stattfindende Urlaube) verknüpfen sich zu einer Erinnerung. Passen zwei Netze wie deckungsgleich übereinander, entsteht ein Déjà-vu-Erlebnis. Das Gestalten von audiovisuellen Räumen ist ein undankbares Unterfangen wenn die Wahrnehmung einer multimedialen Setzung beliebig erscheint.
Tilman Küntzel 2008