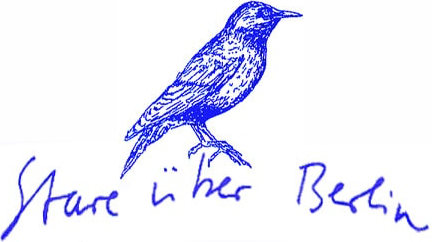presented at: Pomezia Light Festival Pomezia (county Rom, It.) 2018, Kronach leutet Kronach 2018, International Light Art Award (ILAA) Zentrum für Internationale Lichtkunst Unna 2017, The Ghost in the Mashine Villa du parc des Tanneurs, Rennes (F) + Musée d’art et d’histoire Saint-Brieuc (F) 2016, SoundSeeing V Städtische Galerie Ahlen 2013, Die Blaue Nacht Nürnberg 2013, Parliament Rennes (Fr) 2011, Le Bon Accueil Rennes (F) 2010, Klangraum Flensburg Museumsberg Flensburg 2007, Kunst im Georgengarten Dessau 2006, Festival Electric Renaissance Halle a.d. Saale 2005, Singuhr – Hörgalerie in Parochial Berlin 2004, Rencontres Internationales Paris/Berlin Podewil, Berlin 2003, Rohkunstbau 2003 Wasserschloss Gross Leuthen/Spreewald 2003.
The audiovisual installation Fallen Chandelier is based on a sonification of a controlling system causing the flickering of forty light bulbs within a fallen chandelier. Twenty interconnected starters, similar those commonly found in fluorescent tubes, generate an irregular light rhythm. This occurs by means of bimetallic strips which are heated up in a tube and thus come in contact with one another in rapid sequence. This process is audible. Each starter generates its own rhythm, which has a different sound depending on the brand, make-up, and degree of wear of the starters. „I first listen to a lot of starters before I use them for an installation in the sense of composing.“
Ein Kronleuchter liegt, wie von der Decke gefallen, im Raum. Das Licht der 50 flackernden Glühbirnen des Lüsters bricht sich in den Glaskristallen, so dass spektralfarbene, tanzende Lichtbewegungen den Raum ertasten. Die Lichtbewegungen generieren sich selbstständig durch Fehlschaltungen, indem ein Starter aus Leuchtstoffröhren in den Stromkreislauf jeweils zweier Glühbirnen montiert wird. Im Innern des Starters befinden sich ein mit Gas gefülltes Röhrchen und zwei Kontakte. Bei Stromzufuhr erhitzt sich das Gas, die Kontakte berühren sich und leiten den Strom zur Glühlampe. Das Gas kühlt ab, der Lichtkreislauf wird unterbrochen und generiert sich erneut, unentwegt und schnell und produziert so das Flackern der Glühbirnen. Die Schaltgeräusche der Kontakte begleiten diesen Prozess: 25 Starter erzeugen 25 individuelle Rhythmen, die durch Lautsprecher im Raum verteilt werden. Es geht um Rhythmus, um das Zusammenspiel von Klang und Raum. Licht und Ton nimmt der Betrachter als unterschiedliche Ebenen wahr, deren Zusammenhang sich ihm nicht zwangsläufig erschließt und so eine ästhetische Spannung erzeugt. Der Kronleuchter selbst behält in dieser technisch bedingten Inszenierung seine poetische Geste: Er scheint, wie in einer Filmsequenz, seine eigene Geschichte zu erzählen.